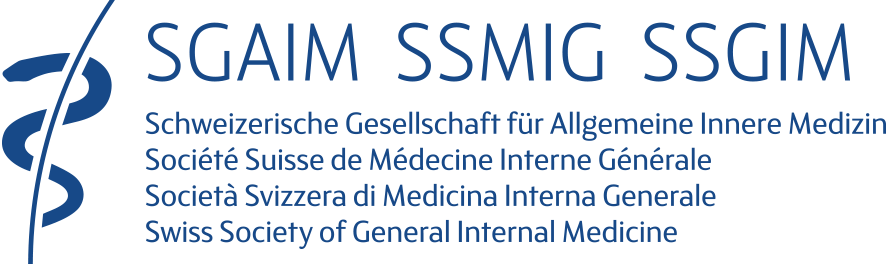01 - Interview mit einer Kodierrevisorin
Die SGAIM präsentiert im Rahmen einer Sonderreihe Stakeholder im Gesundheitswesen und stellt wichtige Player der stationären Leistungsabrechnung rund um SwissDRG vor. Wir beginnen mit dem Thema Kodierrevision und führen ein Interview mit Catherine Niederer-Addor. Sie arbeitet seit fast 15 Jahren als medizinische Kodiererin mit eidg. Fachausweis, ist seit 2018 in der Leitung der medizinischen Kodierung im Spitalzentrum Biel und steht nebenberuflich als Kodierrevisorin der NICE Computing AG für Revisionen und ab 2026 als Geschäftsleitung zur Verfügung.
Was macht eine Kodierrevisorin genau – und warum sollte das Ärzte interessieren?
Eine Kodierrevision ist gesetzlich vorgeschrieben und wird jährlich von den Spitälern durchgeführt[1]. Dazu werden Firmen mit eidgenössisch anerkannten Kodierrevisorinnen und Kodierrevisoren von den Spitälern engagiert. Als Kodierrevisorin überprüfe ich Einzelfälle, die als Stichprobe aus dem gesamten Jahresdatensatz gezogen werden. In der Regel handelt es sich um rund 100 Fälle. Ich erhalte Zugriff auf das Spital-KIS[2] und habe dieselben Dokumente wie die interne Kodierung zur Verfügung. Ich kodiere den Fall und vergleiche ihn anschliessend mit der Spitalkodierung. Abweichungen zu Codes, DRG oder CW werden dokumentiert. Kodierabweichungen ohne Relevanz für DRG oder CW[3] gelten ebenfalls als Fehler.
Durch die Kodierrevision wird in erster Linie die Kodierqualität offengelegt. Zudem können technische Mängel in den Systemen (z. B. Automatisierungen wie ADL bei stationärer Reha) sowie Aussagen zur Berichtsqualität identifiziert werden. Die Austrittsberichte, Operations- und IPS-Berichte dienen der Kodierung als Basis. Nur durch einen präzisen und detaillierten Bericht kann die Spitalkodierung den Fall korrekt kodieren – und die korrekte Kodierung bildet wiederum die Grundlage für eine korrekte Fakturierung des dem Spital zustehenden Erlös für die Behandlung.
Fällt der Erlös aufgrund einer fehlerhaften Kodierung infolge eines ungenauen Berichts zu niedrig aus, wirkt sich dies auf das Finanzergebnis, das Spitalbudget und damit auch auf die Löhne aller Mitarbeitenden aus. Daher ist es wichtig, die Revisionsresultate der eigenen Klinik – üblicherweise nach Abschluss der Revision – intern bekannt zu machen, um daraus geeignete Massnahmen abzuleiten und die Ertragssicherung zu gewährleisten.
Welche Qualifikationen und Erfahrungen muss eine Revisorin mitbringen?
Nebst dem eidg. Fachausweis als Med. Kodiererin muss man als Revisorin auf der Revisorenliste des BfS[4] registriert sein. Für jedes der 3 Abrechnungssysteme (SwissDRG, STReha, TARPSY) gibt es eine eigene Revisorenliste. Folgende Anforderungen müssen erfüllt sein:
- Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung (bei vollem Pensum) im Bereich der medizinischen Kodierung
- Revision unter TARPSY: Bestätigung einer psychiatriespezifischen Weiterbildung im Bereich Kodierung (Anwendung der Kodierungsregeln für HoNOS/CA bzw. ANQ-Anforderung an HoNOS/CA) oder mindestens 1-jährige Berufserfahrung (100% Pensum) in der Psychiatrie.
- Revision unter ST Reha: Bestätigung einer rehabilitationsspezifischen Weiterbildung im Bereich Kodierung (Anwendung der Kodierungsregeln für die Messinstrumente in der Rehabilitation: ADL, CIRS, 6-MinutenGehtest (CHOP-Ko des AA.-) / ANQ-Anforderung an die Messinstrumente in der Rehabilitation) oder mindestens 1-jährige Berufserfahrung (100% Pensum) in der Rehabilitation.
Was passiert bei Auffälligkeiten in der Revision?
In meiner Funktion als Revisorin bin ich vollkommen unabhängig, neutral und unparteiisch. Ich bin berechtigt, im Rahmen einer Revision Kodierungen zu streichen oder zu ändern – auch wenn dies zu einem Wechsel der Fallpauschale (CW-Wechsel) führt –, selbst dann, wenn der Fall bereits von der Krankenkasse vergütet wurde. Gemäß Reglement dürfen Fälle, die im Rahmen der Revision zu einem DRG-Wechsel führen, nicht nachträglich umcodiert und neu fakturiert werden.[5] Die Kommunikation erfolgt in der Regel ausschliesslich mit den Kodierfachpersonen, welche meine primären Ansprechpersonen im Spital darstellen. Die Revisionsberichte müssen Kantonen, Versicherungen und dem BfS zur Verfügung gestellt werden. Die zulässige Fehlerquote im Rahmen von Kodierrevisionen beträgt maximal 5%[6]. Werden bei einem Spital systematisch zu hohe Kodierungen festgestellt, geraten diese Einrichtungen zunehmend in den Fokus von Versicherern und kantonalen Aufsichtsbehörden. In solchen Fällen kann es zu Einzelfallprüfungen, Rückforderungen und – bei nachgewiesenem systematischem Upcoding – sogar zu einem Strafverfahren kommen. Die Kodierqualität hat damit direkten Einfluss auf die Revisionsresultate, die Reputationslage, die Verhandlungsposition gegenüber Versicherern und nicht zuletzt auf die betriebliche Stabilität des Spitals. Eine gute Kodierpraxis ist somit entscheidend für die langfristige Betriebs- und Verhandlungsfähigkeit einer Institution im Gesundheitswesen.
Welche häufigen Fehler zeigen sich in der Schweiz, besonders in der AIM?
Anhand meiner praktischen Tätigkeit und der Revisionstätigkeit mit Einsicht in die ärztlichen Dokumente einer Vielzahl an Spitälern komme ich regelmässig zu folgenden Beobachtungen:
- Die Bedeutung der Dokumentation als Basis für die Endrechnung des Falles ist den Ärzten nicht durchgehend bewusst. Obwohl die Abrechnung nicht zum Kerngeschäft gehört, sollte die Erlössicherung des Spitals als zentrale Zielgrösse stärker berücksichtigt werden.
- Das Erstellen von Berichten wird in der Ausbildung (Studium) zu wenig gelernt
- Es besteht eine ungenügende Begleitung von UA/AA/OA[7] im Spital hinsichtlich Berichterstellung bei knappen personellen Ressourcen. Dies führt zu Qualitätseinbussen durch unreflektierte Copy-and-Paste-Diagnosen in den Berichten.
Welche Fehler kosten Spitäler bei internistischen Patienten am meisten Geld?
- Nicht sachgerecht abgebildete Diagnosen: Einzelne Diagnosen werden zwar gelistet und kodiert, doch fehlen präzise Angaben zu den Zusammenhängen zwischen Diagnosen, weshalb keine DRG-relevanten Kombinationscodes verwendet werden können (z. B. hypertensive Herzinsuffizienz und/oder hypertensive Niereninsuffizienz).
- Unvollständige Evidenz zu Scores und Komplikationen: SOFA-Score-Punkte werden dokumentiert, aber nicht hinreichend durch die aktuelle Dokumentation belegt; wichtige Organkomplikationen einer Sepsis werden ggf. nicht erfasst.
- Vernachlässigte Pflegediagnosen und Nebendiagnosen: Dekubiti, Malnutrition und ähnliche Begleiterkrankungen werden häufig übersehen und nicht dokumentiert.
- Mangelnde Spezifikation der Demenz: Demenz mit Angabe der Ätiologie (z. B. Demenz im Rahmen von M. Parkinson) wird oft nicht präzise dokumentiert.
- Unpräzise Diagnosen: Allgemeine Diagnosen wie Herzinsuffizienz ohne ausreichende Spezifikation (z. B. hypertensiv, links/rechts-spezifisch, NYHA-Stadium) oder Niereninsuffizienz ohne Ätiologie.
Wie können Ärzte ihre Dokumentation verbessern, um Abrechnungsprobleme zu vermeiden?
In erster Linie müssen die Ärzte nicht die Dokumentation nur für die Abrechnung verbessern. Diese Dokumente dienen ebenfalls im Fall einer Klage zu ihrer Absicherung; mit der durchschnittlichen momentanen Qualität wären viele Dokumente aktuell ungenügend.
Ich finde es wichtig, dass dieses Thema am Ende des Studiums behandelt wird, und zwar von Personen, die das System verstehen und das Know-how dazu haben. Sobald ein Arzt die praktische Tätigkeit aufnimmt, erhält das Thema Dokumentation nicht mehr die nötige Wichtigkeit und gerät in den Hintergrund. Dies ist kein Vorwurf an die jungen Mediziner, sondern an den Inhalt des Studiums, der sich im Wandel des Systems ebenfalls anpassen müsste.
Die medizinische Dokumentation soll so vollständig und präzise wie möglich, und wahrheitsgetreu geführt werden. So hat der medizinische Kodierer die optimale Grundlage zur Ermittlung korrekter DRGs. Argumente, Diagnosen und Prozeduren, die nicht verteidigt werden können, schaden der Glaubwürdigkeit und würden kurzfristigen Erfolgen wie höhere Einnahmen mit folgenden rechtlichen Konsequenzen und Vertrauensverlust von Kostenträgern (inklusive stark erhöhter Rückweisungen) nicht gerechtfertigt.
Reicht es, eine Diagnose in der Diagnoseliste zu erwähnen, oder braucht es immer eine Begründung für deren Relevanz?
Diagnosen sind vorzugsweise in der Diagnoseliste im Austrittsbericht beschrieben, können aber auch in der Epikrise der Berichte oder in der Verlaufsdokumentation beschrieben werden. Nur ärztlich gestellte Diagnosen dürfen für die Kodierung verwendet werden. Zudem muss ein dazugehöriger Aufwand nachvollziehbar dokumentiert sein, sei es diagnostische oder therapeutische Massnahmen oder erhöhter Betreuungs-, Pflege und/oder Überwachungsaufwand. Obwohl die Kodierer einen medizinischen Hintergrund haben, dürfen sie keine Diagnosen anhand der Berichte stellen. Es gilt: Die Kodiererin bzw. der Kodierer stellt keine Diagnosen. Sie/er interpretiert auch keine Arzneimittellisten, Laborergebnisse oder Pflegedokumentation ohne dokumentierte Rücksprache mit der behandelnden Ärztin bzw. dem behandelnden Arzt.
Wie detailliert sollten Medikamentengaben und deren Indikation dokumentiert werden, damit sie kodierrelevant sind?
Zu jedem im Spital verabreichten Medikament muss im Austrittsbericht mindestens eine zugehörige Diagnose vermerkt sein. Die einzelnen Medikamente müssen jedoch nicht alle im Bericht aufgelistet sein, da diese im KIS erfasst sind und bei Bedarf auch ausgewiesen werden können. Auch von Patientinnen und Patienten selbst mitgebrachte Medikamente, die vom Spital nicht direkt verabreicht oder umgestellt werden, werden vom Spital reguliert und verordnet; dort können ebenfalls die zugehörigen Diagnosen kodiert werden – sofern die Zusammenhänge nachvollziehbar dokumentiert sind. In der Praxis gehen solche Diagnosen beim Erstellen des Berichts oft verloren. Hochpreisige Medikamente führen zu einem Zusatzentgelt und müssen im Austrittsbericht in der korrekt verabreichten Dosis ausgewiesen werden.
Sehen Sie Trends oder zukünftige Veränderungen, die Ärzte auf dem Schirm haben sollten?
Die Zeiten, dass ein medizinischer Bericht alleinig als Kommunikationsmittel für den Nachsorger verfasst wurden, sind vorbei. Anforderungen an die medizinische Dokumentation sollten daher so einfach wie möglich, zugleich präzise und vollständig sein, und dies sowohl trainiert als auch digital unterstützt werden.
Das Abrechnungssystem passt sich jährlich stärker den von den Spitälern gelieferten Daten an. Von zentraler Bedeutung ist, dass die Kodierabteilung bzw. das Medizincontrolling die Ärztinnen und Ärzte rechtzeitig über Änderungen für das kommende Jahr informiert. Die Ärztinnen und Ärzte sollten diese Informationen in ihren Abteilungen weitergeben, die notwendigen Anpassungen an Berichten erarbeiten, dokumentieren und umsetzen.
Künstliche Intelligenz (KI) wird die Kodierabteilungen künftig positiv unterstützen – davon bin ich überzeugt. Bereits jetzt lässt sich durch Automatisierung ein Gewinn erzielen. Eine korrekte Automatisierung erfordert jedoch eine solide Basis, was in einem Spital mit hoher Mitarbeiterzahl herausfordernd ist. Daher bin ich überzeugt, dass an der Qualität der Basisschritte gearbeitet werden muss, damit KI künftig besser unterstützen kann.
Ich sehe KI nicht als Bedrohung für Kodierarbeitsplätze, sondern als Veränderung der Teams. Die KI kann bereits jetzt einfache Fälle in guter Qualität kodieren, was langfristig vermutlich zu mehr spezialisierten Kodierprofis und Fallmanagementbetreuern führt und weniger Bedarf an Kodieranfängern besteht – was eine Entwicklung mit gegensätzlichen Auswirkungen ist.
Was möchten Sie den Allgemein-Internisten mitgeben?
Eine medizinische Dokumentation präzise und vollständig zu führen, ist nicht einfach. Darauf sind die Spitäler und die Revisoren jedoch angewiesen. Das heisst, wenn das Kodierteam Rückfragen zu Fällen startet, hat dies meist Ertragsrelevanz und diese sollten schnellstmöglich beantwortet werden.
Systematische Fehler werden in den obligatorischen Revisionen oftmals nicht ausreichend erhoben, respektive ist es schwierig, bei kleiner Stichprobe zu entdecken. Daher vertrauen Sie in das Kodierteam, versuchen Sie, dessen Rückmeldungen wahrzunehmen und bei künftigen Dokumentationen vermehrt darauf zu achten. Nehmen Sie Austausche, DRG-Reportings als Chance für die Ertragssicherung ihrer Klinik wahr.
[1] SwissDRG Reglement Kodierrevision Version 13.0
[2] KIS = Klinikinformationssystem
[3] CW = Kostengewicht
[4] BfS = Bundesamt für Statistik, Revisorenliste und Informationen zur Revision vom BfS: Revisionen von Kodierfällen | Bundesamt für Statistik - BFS
[5] Reglement für die Durchführung der Kodierrevision unter SwissDRG: https://www.swissdrg.org/de/akutsomatik/swissdrg-system-1402025/kodierrevision
[6] Laut Reglement für die Durchführung der Kodierrevision unter SwissDRG: Die Fehlerspanne bei einem Konfidenzniveau von 95% muss kleiner als 0.02 sein.
[7] UA = Unterassistent:Innen, AA = Assistenzärzt:Innen, OA = Oberärzt:Innen