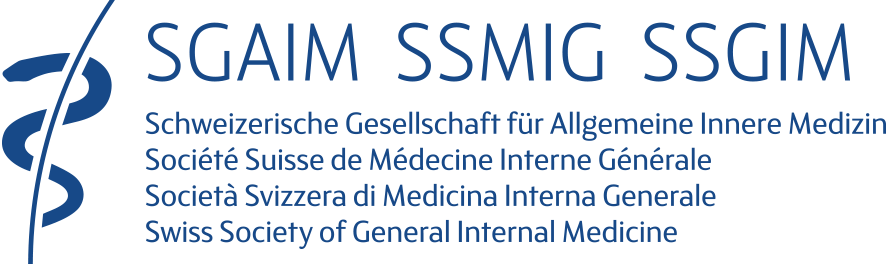02 - Interview mit einer Krankenversicherung
Die SGAIM präsentiert im Rahmen einer Sonderreihe Stakeholder im Gesundheitswesen und stellt wichtige Player der stationären Leistungsabrechnung rund um SwissDRG vor. Zum Thema Rechnungsprüfung sprechen wir mit Philippe Weber. Er ist seit bald 14 Jahren bei der CSS tätig und leitet seit neun Jahren als Gruppenleiter Leistungsprüfung SwissDRG den Bereich Medizinische Kodierprüfung. Mit seiner Ausbildung als Pflegefachmann HF, einem Nachdiplomstudium in Notfallpflege und gezielten Weiterbildungen in Leadership vereint er medizinisches Fachwissen mit moderner Führung. So bringt er frische Impulse und umfassende Kompetenz in die Leistungsprüfung und Prozessoptimierung bei der CSS ein.
Wie läuft eine Rechnungskontrolle bei Ihnen ab? Welche Schritte durchläuft eine Rechnung?
Die Leistungsprüfung erfolgt nach einem regelbasierten und hochautomatisierten Prüfprozess. Nach der elektronischen Übermittlung durch die Leistungserbringer werden die Rechnungs- und medizinischen Kodierdaten (Medical Clinical Dataset) automatisiert auf Vollständigkeit, Plausibilität und Regelkonformität geprüft. Im nächsten Schritt werden die Daten durch ein umfassendes Regelwerk im Leistungsprüfungssystem versicherungstechnisch und administrativ überprüft. Dabei werden folgende Angaben kontrolliert: Zuständigkeit als Kostenträger, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben gemäss Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) und Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV), mögliche doppelte Fakturierung sowie die Vollständigkeit und Aktualität der ICD-10- und CHOP-Daten. Zusätzlich wird geprüft, ob die Daten dem aktuellen XML-Standard entsprechen, der Behandlungsgrund (wie Mutterschaft, Invalidität oder Unfall) korrekt angegeben ist und ob alle tariflichen sowie vertraglichen Vorgaben eingehalten werden. Auch die Preisberechnung anhand der Baserate erfolgt automatisiert.
Werden im Rahmen dieser Prüfungen Unstimmigkeiten oder Auffälligkeiten festgestellt, übernehmen fachlich qualifizierte Mitarbeitende die weitere manuelle Einzelfallprüfung. Ergibt die Prüfung keine Unregelmässigkeiten, prüft anschliessend ein spezialisiertes Team von medizinischen Kodiererinnen und Kodierern, ob die Abrechnung korrekt und medizinisch nachvollziehbar ist. In einem ersten Schritt erfolgt eine automatisierte Kodierprüfung anhand eines umfassenden formalen und medizinischen Regelwerks. Der Fokus liegt dabei auf der Einhaltung der aktuellen Instrumente zur medizinischen Kodierung sowie auf der medizinischen Nachvollziehbarkeit der abgerechneten Leistungen. Treten Fehler oder Diskrepanzen auf, leitet das Prüfsystem die betreffenden Fälle zur weiteren manuellen Beurteilung an unser Spezialteam mit erfahrenen medizinischen Kodiererinnen und Kodierern weiter. Entspricht die Kodierung den Vorgaben und sind die Leistungen medizinisch nachvollziehbar, wird die Rechnung bezahlt.
Bleiben Fragen offen, fordern wir die zur Beurteilung notwendigen medizinischen Unterlagen beim Leistungserbringer an. Nach deren Eingang führen wir eine vertiefte medizinische Kodierprüfung durch. Ergibt diese Prüfung ein abweichendes Resultat, beanstanden wir den Fall schriftlich beim Leistungserbringer. Andernfalls schliessen wir die Kodierprüfung ab und geben die Rechnung zur Zahlung frei.
Dank unseres strukturierten und weitgehend automatisierten Prozesses werden rund 88% der Rechnungen automatisiert geprüft (Dunkelprüfung) und verarbeitet – ganz ohne manuellen Eingriff. So stellen wir sicher, dass der Zugriff auf Daten stets verhältnismässig und zweckgebunden erfolgt und alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.
Nach welchen Kriterien prüfen Sie Rechnungen auf Fehler oder Unstimmigkeiten?
Wir prüfen jede Rechnung nach klaren Kriterien. Dabei orientieren wir uns an den Instrumenten zur medizinischen Kodierung, insbesondere an den Kodierrichtlinien und Klassifikationssystemen wie ICD-10 und CHOP. Zusätzlich halten wir uns an die gesetzlichen Vorgaben (KVG und KLV) und an unsere Verträge mit den Leistungserbringern.
Auch betriebswirtschaftliche Aspekte sind uns wichtig. Bei rund 230'000 Rechnungen pro Jahr im stationären Bereich (Obligatorische Grundversicherung) achten wir darauf, verantwortungsvoll und effizient mit den Prämiengeldern unserer Kundinnen und Kunden umzugehen. Deshalb halten wir die Verwaltungskosten so tief wie möglich und setzen unsere Ressourcen gezielt dort ein, wo sie den grössten Nutzen bringen.
Bei den manuellen Prüfungen konzentrieren wir uns auf jene Fälle, bei denen wir erfahrungsgemäss häufiger Fehler oder Unstimmigkeiten mit finanziellen Auswirkungen feststellen. So nutzen wir unsere Ressourcen effizient und stellen sicher, dass die Rechnungsprüfung sowohl qualitativ als auch wirtschaftlich bleibt. Damit erfüllen wir unsere gesetzlichen und vertraglichen Pflichten und übernehmen Verantwortung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden.
Welche Rolle spielt die Automatisierung in der Rechnungskontrolle – und wo wird noch manuell geprüft?
Wir sind stolz darauf: Durch automatisierte Prüfmechanismen können rund 88 % der Rechnungen effizient und ohne manuellen Eingriff verarbeitet werden.
Manuelle Prüfungen erfolgen dort, wo die automatisierten Systeme Unstimmigkeiten, Auffälligkeiten oder komplexe Sachverhalte feststellen. Fachlich qualifizierte Mitarbeitende übernehmen dann die detaillierte Prüfung, insbesondere bei medizinisch anspruchsvollen Fällen, ungewöhnlichen Fakturierungen oder wenn zusätzliche Unterlagen notwendig sind. So stellen wir sicher, dass auch in komplexen oder strittigen Situationen eine fachgerechte und korrekte Beurteilung erfolgt. Bei Bedarf ziehen wir zusätzlich den Vertrauensarzt bei.
Mit welchen typischen Fehlern oder Unstimmigkeiten in Rechnungen sind Sie besonders häufig konfrontiert, und gibt es bestimmte Fachbereiche, Diagnosen oder internistische Fälle, bei denen besonders oft Korrekturen, Rückweisungen oder Nachverhandlungen mit Spitälern und Versicherungen erforderlich sind?
Typische Fehler oder Unstimmigkeiten in Rechnungen betreffen häufig intensivmedizinische Komplexbehandlungen, die Aufenthaltsdauer beziehungsweise Wartetage sowie Diagnosen wie Hyponatriämie oder Energie- und Eiweissmangelernährung. Auffällig sind auch Spezifizierungen von Diagnosen, die in der medizinischen Dokumentation nicht belegt oder dokumentiert sind, beispielweise Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz, Demenz oder Delir. Allgemein treten Probleme oft dann auf, wenn Diagnosen oder Leistungen abgerechnet werden, die in den Unterlagen nicht nachvollzogen werden können.
Wie lösen Sie strittige Fälle? / Wie oft kommt es zu Streitfällen mit Leistungserbringern – und wie werden diese gelöst?
Seit der Einführung des Tarifes SwissDRG ist die Qualität der medizinischen Kodierung deutlich gestiegen. Offensichtliche Fehler kommen heute nur noch selten vor. Streitfälle entstehen vor allem bei komplexen medizinischen Sachverhalten und in sogenannten Graubereichen, wo die Regeln nicht eindeutig sind. Häufig geht es dabei um Situationen, in denen die Leistungserbringer die Tarife stark ausreizen oder die Kodierung an der Grenze des Zulässigen liegt. Weil die Fälle immer komplexer werden und der Kostendruck auf die Spitäler steigt, nehmen die Zahl der Wiedererwägungen und der Aufwand pro Prüfung laufend zu.
Strittige Fälle klären wir mit gut begründeten und verständlichen schriftlichen Stellungnahmen. Gerade in Graubereichen ist eine transparente und sachliche Argumentation besonders wichtig, da die Rechtslage oft nicht eindeutig ist. Wir setzen deshalb auf eine offene Kommunikation. Falls wir uns schriftlich nicht einigen können, suchen wir das persönliche Gespräch.
Erst wenn auch dann keine Einigung möglich ist und wir überzeugt sind, dass unsere Sichtweise korrekt ist, wenden wir uns an das Kodiersekretariat des Bundesamtes für Statistik. Dies ist jedoch der letzte Schritt im Prozess, den wir möglichst vermeiden möchten. Wir sind bestrebt, die Fälle direkt und partnerschaftlich mit den Leistungserbringern zu lösen.
Welche Dokumentationsmängel erschweren eine korrekte Rechnungsprüfung am meisten?
Oft sind die medizinischen Unterlagen unvollständig, widersprüchlich oder unklar. Häufig fehlen wichtige Angaben zu Diagnosen, Behandlungsverläufen oder erbrachten Leistungen – insbesondere bei Komplexbehandlungen, für die bestimmte Mindestmerkmale gelten. Solche Mängel erschweren es uns, die medizinische Notwendigkeit und die korrekte Kodierung der abgerechneten Leistungen zu prüfen.
Fehlende oder unklare Unterlagen verursachen sowohl bei den Leistungserbringern als auch bei der CSS einen erheblichen Mehraufwand, da wir zusätzliche Abklärungen treffen und weitere Unterlagen nachfordern müssen. Das verzögert die Prüfung, die Zahlung der Rechnung und verursacht für alle Beteiligten unnötige Kosten. Eine lückenlose, strukturierte und transparente Dokumentation, wie sie das Gesetz verlangt, ist deshalb entscheidend für eine effiziente und korrekte Prüfung.
Was erwarten Sie von Ärzten und Spitälern, um die Rechnungskontrolle effizienter zu machen?
Für eine effiziente Leistungsprüfung benötigen wir von Ärztinnen/-en und Spitälern eine vollständige, strukturierte und transparente medizinische Dokumentation. Alle relevanten Angaben zu Diagnosen, Behandlungen und erbrachten Leistungen müssen klar und nachvollziehbar sein. Die Kodierung soll nach den aktuell geltenden Richtlinien erfolgen. Eine offene Kommunikation bei Rückfragen und die zeitnahe Bereitstellung fehlender Unterlagen unterstützen den Prüfprozess zusätzlich. Verzögerungen bei der Zustellung der Dokumente führen zu mehr Aufwand – für alle.
Ich möchte zudem betonen, dass wir als Kostenträger nicht für die gesetzlichen Vorgaben und Abrechnungsregeln verantwortlich sind. Die Diskussion über Sinn oder Unsinn der geltenden und teilweise durchaus fraglichen Abrechnungsvoraussetzungen sollte daher nicht mit uns geführt werden. Vielmehr wünsche ich mir, dass sich die Ärzteschaft und die Spitäler ebenfalls aktiv für klarere und praxistaugliche Tarife einsetzen. Untervergütete Leistungen dürfen nicht durch alternative, nicht korrekte Abrechnungen kompensiert werden, sondern durch eine faktenbasierte und konstruktive Mitwirkung an der Weiterentwicklung der Tarife über die entsprechenden Institutionen. Nur so kann das System nachhaltig verbessert werden – im Interesse aller Beteiligten.
Welche Trends sehen Sie in den Gesundheitskosten, und wo gibt es aus Ihrer Sicht Einsparpotenzial?
Wir beobachten, dass die Gesundheitskosten in der Schweiz weiterhin stetig steigen, insbesondere im Bereich der stationären Behandlungen und bei komplexen medizinischen Leistungen. Gründe dafür sind unter anderem der medizinische Fortschritt, die demografische Entwicklung sowie die kontinuierliche Erweiterung des Leistungskatalogs und die vermehrte Inanspruchnahme von Leistungen. Gleichzeitig nehmen die Anforderungen an Dokumentation und Abrechnung zu, was den administrativen Aufwand zusätzlich erhöht.
Einsparpotenzial sehen wir vor allem in der konsequenten Vermeidung von Fehl- und Überversorgung, einer besseren Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten sowie in der Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen. Auch die transparente und vollständige medizinische Dokumentation sowie die korrekte Kodierung helfen, unnötige Kosten zu verhindern. Die Bildung von Netzwerken, in denen Behandlungen gut abgestimmt werden sorgen dafür, dass alle Beteiligten die gleichen Informationen haben und Doppelspurigkeiten im Behandlungsprozess vermieden werden können. Das verbessert die Qualität der Behandlung. Zudem wäre es sinnvoll, die Tarife weiterzuentwickeln und stärker auf medizinisch notwendige und wirtschaftliche Leistungen auszurichten. So können wir die Ressourcen gezielter einsetzen und das Gesundheitssystem langfristig entlasten.
Wie bewerten Sie den Einfluss von Fallpauschalen (SwissDRG) auf die Rechnungsqualität?
Mit der Einführung der Fallpauschalen (SwissDRG) hat sich die Rechnungsqualität insgesamt verbessert – die Abrechnung erfolgt transparenter und strukturierter. Die einheitlichen Regeln fördern eine standarisierte und nachvollziehbare Dokumentation sowie Kodierung der Leistungen. Gleichzeitig hat sich der Fokus auf die korrekte medizinische Kodierung und die Vollständigkeit der Unterlagen deutlich erhöht.
Allerdings beobachten wir auch neue Herausforderungen: Die Komplexität der Kodierung hat zugenommen und es besteht ein gewisser Anreiz, die Kodierung zugunsten einer höheren Vergütung auszuschöpfen. Dies führt zu vermehrten Prüfungen und Diskussionen. Insgesamt hat SwissDRG die Qualität und die Nachvollziehbarkeit der Rechnungen verbessert, verlangt aber von allen Beteiligten ein hohes Mass an Fachwissen und Sorgfalt.
Welche technischen Entwicklungen, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz, werden die Rechnungskontrolle in den nächsten Jahren verändern und ist zu erwarten, dass KI den gesamten Prüfprozess künftig übernehmen wird?
Technische Entwicklungen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz (KI), werden die Leistungsprüfung in den kommenden Jahren deutlich verändern. Schon heute helfen automatisierte Systeme und KI-gestützte Anwendungen dabei, grosse Datenmengen schnell zu prüfen, Muster zu erkennen und Rechnungen zu plausibilisieren. So können Routineaufgaben und Standardfälle zunehmend automatisiert abgewickelt werden.
Ein besonders vielversprechender Ansatz ist die automatisierte Texterkennung, die uns zukünftig dabei unterstützen soll, komplexe medizinische Behandlungsdokumentationen effizient zu lesen und zu verstehen. So können auch umfangreiche und unstrukturierte Unterlagen schneller analysiert und relevante Informationen gezielt herausgefiltert werden.
Wir erwarten, dass der Einsatz von KI weiter zunimmt und die Systeme immer leistungsfähiger werden. Dennoch bleibt der Mensch wichtig – insbesondere bei komplexen oder strittigen Fällen, die eine individuelle fachliche Beurteilung erfordern. KI kann den Prüfprozess also deutlich unterstützen und effizienter machen, wird ihn aber nicht vollständig ersetzen. Die Kombination aus technischer Innovation und fachlicher Expertise bleibt entscheidend für eine qualitativ hochwertige und rechtskonforme Leistungsprüfung.
Erlauben Sie mir, abschliessend noch kurz darauf einzugehen, wie wir als Krankenversicherer den Einsatz von KI auf Seiten der Leistungserbringer spüren: Wir beobachten, dass Spitäler KI zunehmend für systematische Nachkodierungen und Massenrevisionen bereits abgeschlossener Fälle einsetzen. Diese Praxis beeinträchtigt die Datenqualität, erschwert die Budgetplanung und gefährdet die Glaubwürdigkeit sowie die Wirtschaftlichkeit des Abrechnungssystems. Wir setzen uns deshalb für eine transparente und faire Zusammenarbeit ein, bei der die Qualität der Primärkodierung und die Integrität der medizinischen Dokumentation im Vordergrund stehen.
Was möchten Sie den Fachärzten der Allgemeinen Inneren Medizin mitteilen / mit auf den Weg geben?
Wie Ludwig Hasler, Schweizer Philosoph und Redner, einmal treffend sagte: Im Gesundheitswesen treffen zwei unterschiedliche Logiken aufeinander – die Versicherungslogik und die ärztliche Logik. Während die Versicherungslogik versucht, die Welt in klare, budgetierte Kategorien zu ordnen, steht für die Ärztinnen und Ärzte der einzelne Mensch und sein Schicksal im Mittelpunkt. Diese beiden Sichtweisen sind schwer miteinander zu vereinen und führen zwangsläufig zu Konflikten, die nicht einfach gelöst werden können.
Das Ziel sollte nicht sein, diese Konflikte zu beseitigen, sondern sie als Teil des Systems zu akzeptieren und konstruktiv damit umzugehen. Es braucht sowohl die Würdigung des einzelnen Menschen als auch eine Instanz, die die Fürsorge begrenzt, damit das Gesundheitssystem für die Gesellschaft tragbar bleibt. Konflikte sind unter realen Bedingungen nicht dazu da, endgültig gelöst zu werden, sondern sie sollen im Zusammenspiel fruchtbar bleiben.
Wir wünschen uns deshalb eine offene und konstruktive Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Verständnis und Akzeptanz der unterschiedlichen Perspektiven – mit dem gemeinsamen Ziel, tragfähige Lösungen für die Versicherten bzw. die Patientinnen und Patienten zu finden.